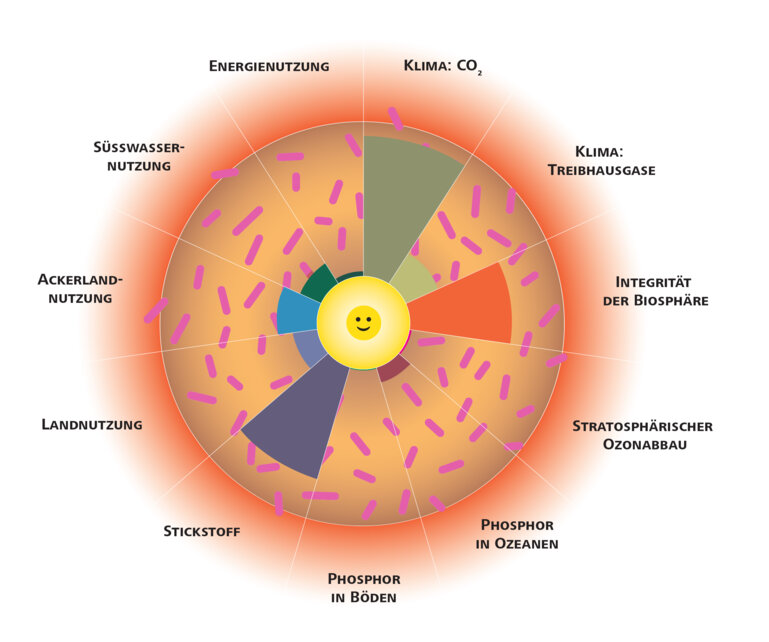Ein Mann in seinem Spiel: 40 Stunden pro Woche verbringt Remo Bollhalder mit dem Game «League of Legends» – ein Vollzeitpensum, das er zusätzlich zu seinem Job bestreitet.
Tic-tic-klack-klack-tic
In rasantem Tempo klickt Remo Bollhalder, Spielername «Sakrod», auf seine Computermaus, nur für Sekundenbruchteile unterbrochen vom Klappern der Tastatur. Bollhalder steuert seine rosarote Spielfigur durch eine virtuelle Landschaft. Wälder, Schluchten und Felsen schimmern knallbunt auf dem Bildschirm. «Sakrod» wirbelt umher und schleudert dabei Feuerbälle auf Zwerge. Aus Bollhalders Headset dröhnen die aufgekratzten Stimmen seiner vier Mitspieler.
«Mist, wieso lebt der noch?»
«Hast du eingekauft, Remo?»
«Ja.»
Bollhalder redet nur das Nötigste, während er seine Spielfigur durch ein Schlussgefecht aus bunten Blitzen und Explosionen dirigiert, bis die gegnerische Basis in einer Druckwelle zerbirst. Bollhalder lehnt sich zurück, hinter seinem Sessel die typischen Ausstattungsmerkmale einer Studenten-WG: halbleeres Büchergestell, aufgestelltes Bügelbrett, Wäsche auf Sporttasche. Nur dass sich Remo Bollhalder und seine Mitspieler nicht einfach durch einen Nachmittag in den Semesterferien zocken. Sie sind E-Sportler, allesamt bei namhaften Schweizer Vereinen unter Vertrag. Ihr Ziel: als Schweizer Auswahl an die Weltmeisterschaft von «League of Legends» in Taiwan reisen. Fünf Tage die Woche trainieren sie, meist mit Spielen gegen Sparringspartner wie heute, um zuvor das Qualifikationsturnier in Zürich für sich zu entscheiden. «Jungs, wir haben uns mit unnötigen Kämpfen abgelenkt», analysiert Bollhalder. Mit 26 ist er der Teamälteste. «Fokussieren wir uns beim nächsten Game. Und plaudert weniger.»
Vom Hobby zur Sportdisziplin
Bollhalder gamt 40 Stunden in der Woche, ist aber meilenweit vom Klischee des Game-Nerds entfernt: ein gepflegter junger Mann, der Kaffee und Mineral trinkt und in charmantem Aargauerdeutsch von seiner Leidenschaft erzählt. Einer Leidenschaft, die gerade einen dramatischen Imagewechsel erlebt. Gamen, einst das besorgniserregende Hobby von blassen Teenagern, wird zur elektronischen Sportdisziplin. Das Herz des E-Sports schlägt in Südkorea und China, wo eigene TV-Kanäle die Wettkämpfe übertragen und die besten Gamer wie Stars gefeiert werden. 655 Millionen Dollar hat der E-Sport 2017 laut dem «Global eSports Market Report» erwirtschaftet. 2018 sollen es bereits 905 Millionen sein. Auch die Preissummen können sich sehen lassen: An der diesjährigen Weltmeisterschaft des Games «Dota 2» ging das Siegerteam mit über elf Millionen Dollar nach Hause – ein neuer Rekord.
Auch in Europa, besonders Deutschland und Polen, ist der professionelle E-Sport kräftig im Aufwind. In der Schweiz ist das Tempo gemächlicher – aber der Trend unverkennbar. E-Sport-Vereine wie «Silent Gaming» oder «MyInsanity» sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Traditionelle Sportclubs machen mit: Seit 2016 hat der FC St. Gallen einen Spieler des Konsolenspiels FIFA unter Vertrag. Lausanne-Sport, wo Remo Bollhalder unter Vertrag steht, verfügt über Teams für sechs Computerspiele. Sponsorengeld kommt inzwischen von grossen Schweizer Unternehmen. «Früher unterstützten Hersteller von IT-Equipment Turniere oder Vereine», sagt Vinzenz Kœgler, der 30-jährige Präsident des Schweizer E-Sport-Verbandes SESF, «heute sind es Firmen wie UPC oder die Bâloise.» Sogar der Touring Club Schweiz baut nun eine eigene Liga für das Game «Rocket League» auf.
Es begann mit dem Gameboy
Noch vor fünfzehn Jahren hätte sich all das niemand träumen lassen. Damals bekam Remo Bollhalder seinen ersten Gameboy in die Hände. «Wenn wir mit dem Wohnwagen in die Ferien fuhren, hingen mein Bruder und ich eigentlich nur am Bildschirm», erzählt Bollhalder grinsend, «von den Ferien kriegten wir nicht viel mit.» Als Teenager wechselte Bollhalder das Equipment: Der PC war leistungsfähiger – und mit Spielern aus aller Welt verbunden. «Gameboy war Spass», erzählt Bollhalder. «Aber das Internet machte Gamen kompetitiv.» Er schaute erfahrenen Gamern zu, durchforstete Internetforen nach Tricks für sein Lieblingsgame «Starcraft 2» und trainierte diese stundenlang. «Die Eltern hatten keine Freude», sagt Bollhalder, «aber in der Schule war ich immer genügend.»
Richtig ernst mit dem Gamen wurde es 2013. Bollhalder besuchte nach der KV-Lehre nur einige Abendkurse als Vorbereitung für die Berufsmatura. Den Rest der Zeit verbrachte er mit seinem neuen Lieblingsgame, dem 2011 erschienenen «League of Legends», kurz «LOL»: ein Strategiespiel mit einer grossen Auswahl von Spielfiguren, die in Fünferteams auf einer gespiegelten Fantasielandschaft gegeneinander antreten. Bollhalder spielte 60 Stunden pro Woche. Rasch kletterte er in der Statistik nach oben. Nach zwei Jahren war er der zweitbeste Spieler in Europa.
Keine Chance in Bukarest
Doch als Einzelkämpfer stiess er an eine gläserne Decke: Professioneller E-Sport ist Teamsport. Anfragen blieben aber aus. Damals rekrutierten sich selbst internationale Teams vor allem aus Freundeskreisen. «Heute würden sich professionelle Clubs um mich reissen», sagt Bollhalder. Er fand schliesslich an einer LAN-Party Anschluss an ein Schweizer Team. Doch das Level hierzulande war mit demjenigen im Ausland nicht vergleichbar. Das merkte Bollhalder, als er 2013 als Mitglied des Schweizer Teams an die «LOL»-Weltmeisterschaft in Bukarest reiste. Die Schweiz hatte im Viertelfinal gegen den Weltfavoriten Südkorea keine Chance.
Danach zog Bollhalder vom Zuhause im Aargau nach St. Gallen, wo er ein Wirtschaftsstudium begann. Er bestritt manchmal noch «LOL»-Turniere, spielte dann aber monatelang wieder andere Spiele. Bis ihn 2017 ein Bekannter anfragte, im offiziellen «League of Legends»-Team des Vereins «Silent Gaming» mitzuspielen. Bollhalder unterschrieb einen Vertrag und trainierte wöchentlich, um an den Turnieren der Swiss E-Sports League, kurz SESL, teilzunehmen. Diese finden meist online statt, nur für die Finalrunden reisen die Teams in Mehrzweckhallen oder in die 2017 eröffneten Zürcher «eStudios» an.
Karriereende
Diesen Sommer wechselte Bollhalders «LOL»-Team zu «E-Sport Lausanne». Der Verein zahlt seinen Spielern ein kleines monatliches Taschengeld, organisiert Übernachtungen bei Turnieren und lud die Spieler sogar für ein zweitägiges Wochenende in den Walliser Bergen – Paintball inklusive – ein. Für eine professionelle Laufbahn wie im Fussball reichen Taschengeld und Paintball-Weekends aber nicht. Spieler beenden ihre Karrieren deshalb oft spätestens nach dem Studium oder der Berufsausbildung, Teams brechen auseinander, bevor sie ihr Potenzial entfalten. An ausländische Turniere schaffen es Schweizer nur selten.
Postfinance will dies ändern. Das Unternehmen startet 2019 ein Pilotversuch: Fünf «League of Legends»-Spieler sollen ein Jahr lang bei einem Monatsgehalt von 2500 Franken in einem «Gaming House» trainieren, einer von Coaches betreuten WG. Genauso wie die Profis in China und Südkorea. Für den Schweizer E-Sport ist das Projekt ein Quantensprung. Doch Remo Bollhalder bewirbt sich nicht dafür. «Vor ein paar Jahren hätte ich keine Sekunde gezögert», sagt er, nicht ohne Bedauern, «aber nun bin ich zu alt.» In einem Jahr beendet Bollhalder sein Studium, drei Tage in der Woche arbeitet er in einer Treuhandfirma.
«Zwanzigjährige kennen das Spiel inzwischen besser als ich»
sagt er. Und haben mehr Zeit. Remo Bollhalder will sich auf die Teilnahme an der WM in Taiwan konzentrieren. Es wäre der zweite Höhepunkt seiner Karriere nach der WM in Bukarest 2013. Und vermutlich der letzte. Danach, überlegt er sich, würde er sich gerne als Coach in einem Verein betätigen. Und nur noch zum Spass gamen. Er grinst. «Ganz aufhören werde ich sicher nicht. Gamen gehört zu meinem Leben.»
Im Breitband-Land
Der Aufstieg des E-Sports geht Hand in Hand mit der Verbreitung von schnellem Internet. Denn im rasanten Online-Wettkampf wäre eine stockende Verbindung ein fataler Nachteil. Mit rund 41 Breitbandanschlüssen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner belegt die Schweiz den Spitzenplatz der OECD-Länder (Stand: 2017). Ein Grossteil der Haushalte hat Zugang zum schnellen Netz, immer mehr auch zur ultraschnellen Glasfaser. Auch punkto Geschwindigkeit liegt die Schweiz vorne: Die durchschnittliche gemessene Downloadgeschwindigkeit gehört zu den höchsten weltweit (Platz 5 der OECD-Länder, 2014) – und dies, obwohl die von den Anbietern angegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten tiefer sind als im Ausland. Eidgenössische Bescheidenheit, möchte man sagen.